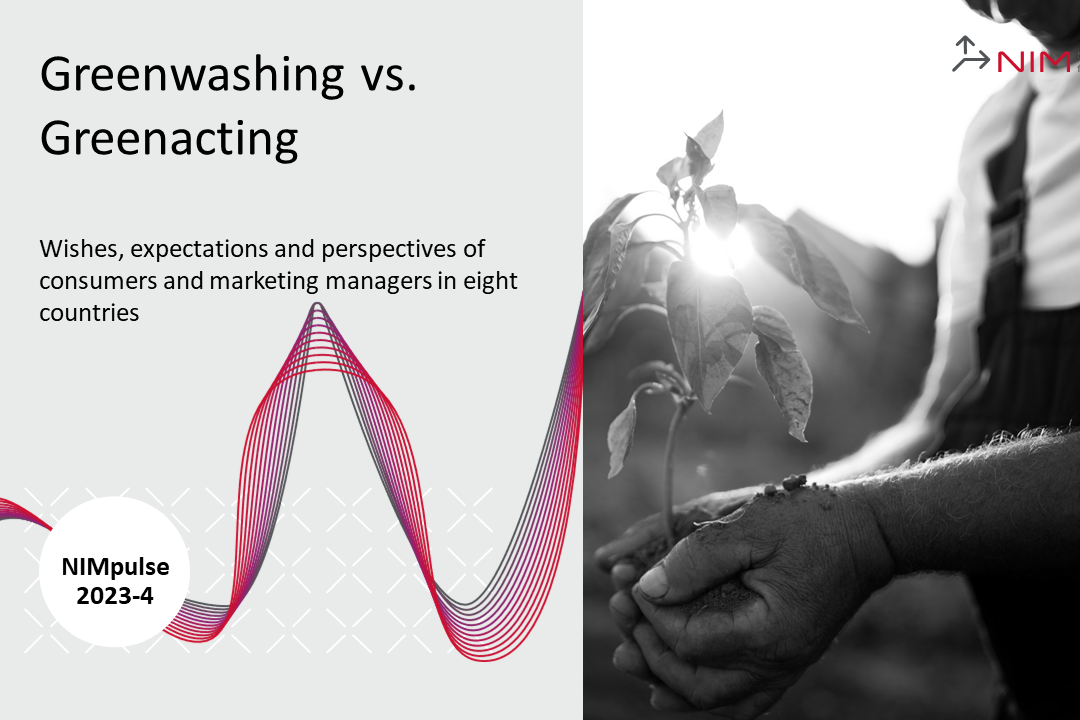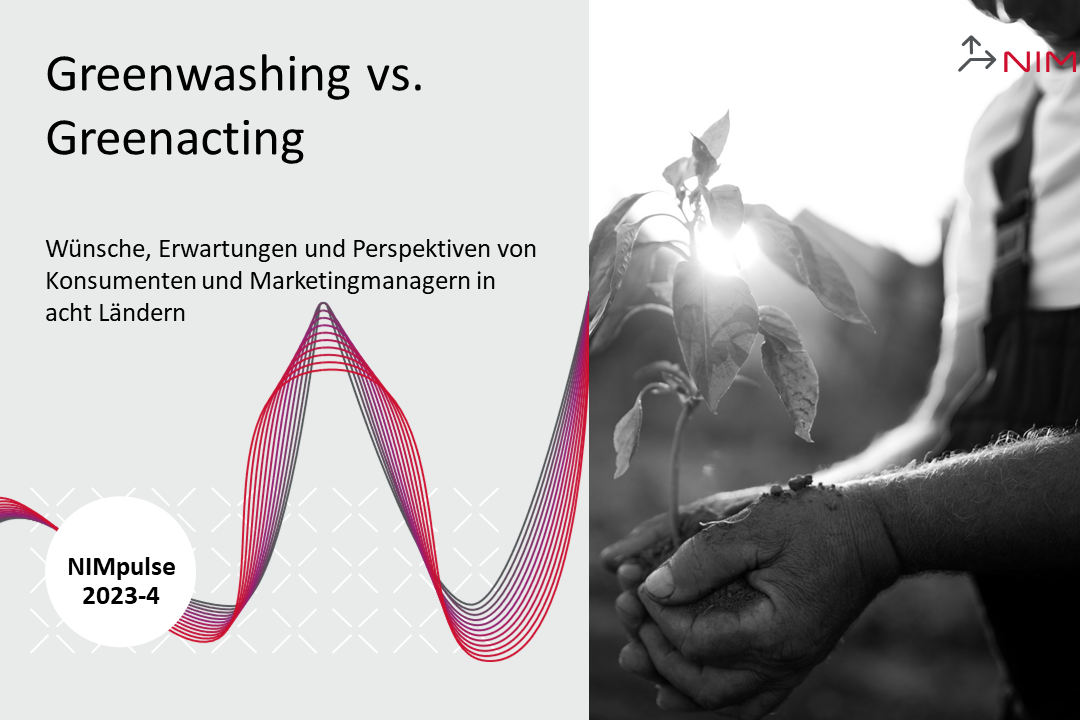Greenwashing
1. Einführung: Was ist Greenwashing?
Definition und Ursprung des Begriffs
Greenwashing bezeichnet die bewusste Irreführung von Verbrauchern über die Umweltfreundlichkeit eines Unternehmens, Produkts oder einer Dienstleistung. Der Begriff setzt sich aus „green“ (engl. für grün, also umweltfreundlich) und „whitewashing“ (engl. für Schönfärberei oder Vertuschung) zusammen. Er wurde erstmals 1986 von dem Umweltaktivisten Jay Westerveld geprägt, als er erkannte, dass Hotels ihre Gäste aufforderten, Handtücher mehrfach zu benutzen – jedoch nicht aus ökologischen, sondern aus rein wirtschaftlichen Gründen (Motavalli, 2016).
Warum Greenwashing ein Problem ist
Greenwashing führt zu einer Täuschung der Verbraucher, die nachhaltige Kaufentscheidungen treffen möchten. Es verstärkt die Informationsasymmetrie zwischen Unternehmen und Konsumenten, da viele nicht über das nötige Fachwissen oder die Mittel verfügen, um die Echtheit von Nachhaltigkeitsaussagen zu überprüfen. Dies führt zu Fehlentscheidungen, verzerrtem Wettbewerb und einem Vertrauensverlust in echte Nachhaltigkeitsbemühungen.
Beispiele aus der Vergangenheit
- Viele Hersteller von Fleischalternativen übertreiben Nachhaltigkeitsvorteile oder stellen irreführende Vergleiche an. Sie vergleichen Seitan zum Beispiel mit Rindfleisch anstatt mit Huhn, um CO₂-Ersparnisse zu maximieren (Klare, 2023).
- Kreuzfahrtgesellschaften heben die Einführung von LNG-betriebenen Schiffen hervor, wobei es sich dabei um ein einzelnes Leuchtturmprojekt handelt, während der Rest der Flotte weiterhin mit Schweröl betrieben wird (Fifka, 2024).
- Autohersteller bewarben ihre Dieselautos als „sauber“, während gleichzeitig illegale Manipulationssoftware genutzt wird, um Emissionstests zu täuschen (Siano et. al 2017).
- Modeunternehmen bewerben Kollektionen als nachhaltige Mode, ohne jedoch ausreichend Informationen darüber bereitzustellen, warum diese Produkte tatsächlich umweltfreundlicher sein sollen als andere (Segran, 2019).
2. Die verschiedenen Formen von Greenwashing
Vage und irreführende Begriffe
Viele Unternehmen nutzen ungeschützte Begriffe wie „natürlich“ oder „regional“, ohne genaue Nachweise oder Definitionen zu liefern. Auch Rohöl ist beispielsweise ein Naturprodukt, und Europa kann ebenfalls als Region angesehen werden (Fifka, 2024).
Fehlende Belege für Umweltversprechen
Oft gibt es keine überprüfbaren Daten oder wissenschaftlichen Nachweise für ökologische Aussagen, sodass Verbraucher nicht nachvollziehen können, ob die Behauptungen der Wahrheit entsprechen (Fifka, 2024).
Versteckte Kompromisse
Ein Produkt mag in einem Punkt umweltfreundlich erscheinen, während es in anderen Bereichen massive Umweltschäden verursacht. Zum Beispiel ein E-Auto mit einer Batterie aus umweltschädlichem Lithiumabbau.
Irreführende Bilder und Marketingtechniken
Verpackungen werden häufig in Grüntönen und Naturmotiven gestaltet, um Umweltfreundlichkeit zu suggerieren. Auch wird Werbung mit Szenen aus der Natur gestaltet, obwohl das Unternehmen keine nachhaltigen Praktiken verfolgt.
Ablenkung von tatsächlichen Umweltproblemen
Ein Unternehmen hebt eine kleine umweltfreundliche Maßnahme hervor, während es in anderen Bereichen massiv umweltschädlich agiert (Fifka, 2024). Beispielsweise bewerben Ölkonzerne einzelne nachhaltige Projekte, während sie weiterhin hauptsächlich fossile Brennstoffe fördern.
„Grüne“ Labels ohne Zertifizierung
Viele Unternehmen nutzen Label, welche ohne viel Aufwand zu erhalten sind oder kreieren Labels gleich selbst. Diese haben teilweise keine offiziellen Standards und unterliegen keinen unabhängigen Prüfungen (Shahrin et al., 2017; Fifka, 2024).
3. Warum Unternehmen Greenwashing betreiben
Verbrauchertrends hin zu Nachhaltigkeit
Etwa 3 von 4 Konsumenten geben an, dass Nachhaltigkeit ihre Kaufentscheidung beeinflusst (Biró & Neus, 2023). Unternehmen möchten diese Wünsche bedienen – jedoch oft ohne echte ökologische Verbesserungen.
Wettbewerbsvorteile und Imagepflege
Nachhaltigkeit wird zu einem zentralen Imagefaktor für Marken. Wer sich als „grün“ präsentiert, gewinnt häufig an Kundenvertrauen – zumindest kurzfristig.
Gesetzliche Grauzonen und mangelnde Regulierungen
- Begriffe wie „klimaneutral“ oder „nachhaltig“ sind nicht gesetzlich geschützt bzw. nicht legaldefiniert.
- In einigen Ländern gibt es kaum Kontrollen oder Strafen für irreführende Umweltversprechen.
- Die EU möchte Green Claims (Nachhaltigkeitsversprechen) in Zukunft stärker regulieren mit dem Ziel, dass Verbraucher die Nachhaltigkeit von Produkten besser einschätzen können.
4. Auswirkungen von Greenwashing auf Umwelt und Verbraucher
Vertrauensverlust bei Verbrauchern
Wenn Greenwashing aufgedeckt wird, schwindet das Vertrauen in nachhaltige Produkte. 7 von 10 Verbrauchern meiden Marken, die des Greenwashings beschuldigt wurden (Biró & Neus, 2023).
Verzögerung echter Nachhaltigkeitsmaßnahmen
Unternehmen investieren möglicherweise eher in Marketing anstatt in nachhaltige Innovationen (Yildirim, 2023). Auch könnten sich staatliche Regulierungen verzögern, weil Greenwashing den Eindruck vermittelt, dass freiwillige Maßnahmen ausreichen.
Soziale Auswirkungen
Viele als nachhaltig beworbene Produkte stammen tatsächlich aus kritischen Lieferketten, die weiterhin schlechte Arbeitsbedingungen oder Umweltzerstörung beinhalten (Daria & Canning, 2023).
5. Wie erkennt man Greenwashing?
Greenwashing zu erkennen erfordert eine aufwendige Prüfung von Werbeaussagen und eine Hintergrundrecherche zu Produkten und Unternehmen. Das ist von Konsumenten praktisch nicht und von Behörden in diesem Umfang kaum zu leisten. Häufig fliegt Greenwashing auf, wenn Insider den Betrug aufdecken oder wenn NGOs intensive Nachforschungen betreiben. Verbraucher können dennoch auf folgende Merkmale achten, um Anhaltspunkte für Greenwashing zu erkennen:
- Kritische Prüfung von Werbeaussagen: Sind Werbeaussagen konkret? Oder handelt es sich eher um vage Aussagen, die gut klingen? Beispiele hierfür sind Begriffe wie "umweltfreundlich" ohne konkrete Beweise.
- Zertifikate und Labels: Nutzen Unternehmen bekannte Zertifikate und Labels, die unabhängig überprüft werden? Oder werden Labels verwendet, die unbekannt sind und ggf. auf eigene Initiative des werbenden Unternehmens zurückgehen?
- Transparenz und Nachweise: Unternehmen, die transparent über ihre Umweltinitiativen berichten und diese durch Daten belegen, sind glaubwürdiger als solche, die vage bleiben.
6. Gesetzliche Regelungen und Maßnahmen gegen Greenwashing
Gesetzliche Regelungen gegen Greenwashing entwickeln sich weltweit weiter. In Deutschland fällt Greenwashing unter das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), das irreführende Werbung verbietet. In der EU wird es eine Richtlinie geben, die Umweltbehauptungen (Green Claims) ohne Beweise verbietet und konkrete Nachweise für Umweltansprüche erfordert (Green Claim Direktive) (Fifka, 2024).
7. Fazit und Ausblick
Durch Greenwashing entsteht großer Schaden. So kaufen Verbraucher Produkte, die nicht ihren ethischen Standards entsprechen. Unternehmen, die wirklich nachhaltig agieren, und dadurch etwa höhere Preise verlangen müssen, leiden unter Kundenschwund. Und schließlich verliert die Natur, da nicht nachhaltige Produkte in der Regel unter erhöhtem Ressourcenverbrauch oder unter Einsatz besonders umweltschädlicher Verfahren hergestellt werden. Nur wenn es für Verbraucher, aber auch für Unternehmen zukünftig klarer ist, wann es sich um Nachhaltigkeit handelt und wann nicht, kann Greenwashing zurückgedrängt werden. Das wird nicht ohne gesetzliche Regelungen und strengere Kontrollen gehen. Solche Maßnahmen werden auch von Verbrauchern, aber auch Unternehmen weltweit gewünscht (Biró & Neus, 2023).
8. Quellen und weitere Nachweise
Siano, A., Vollero, A., Conte, F., & Amabile, S. (2017). “More than words”: Expanding the taxonomy of greenwashing after the Volkswagen scandal, Journal of Business Research, Volume 71, 2017, 27-37, ISSN 0148-2963, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.11.002.
Biró, T., & Neus, A. (2023). Greenwashing vs. Greenacting: Wünsche, Erwartungen und Perspektiven von Konsumenten und Marketingmanagern in acht Ländern. NIMpulse 2023-4.
Buder, F. (2024). Imagine a Smartphone that not only connects you to the world but also respects it. NIM Insights Research Magazine VOL. 4, 46-49.
Daria, J., & Canning, A. (2023). Certified Exploitation: How Equitable Food Initiative and Fair Trade USA Fail to Protect Farmworkers in the Mexican Produce Industry. Corporate Accountability Lab.
Fifka, M. (2024). 50 Shades of Green(washing) — The Challenge of Communicating Sustainability Convincingly. NIM Insights Research Magazin VOL. 4, 12-17.
Klare, S. (2023). Good for the environment and the image? Greenwashing among producers of meat substitutes. Bachelor thesis in Economics, FAU Erlangen-Nuremberg.
Li, M., Trencher, G., & Asuka, J. (2022). The clean energy claims of BP, Chevron, ExxonMobil and Shell: A mismatch between discourse, actions and investments. PLOS ONE 17(2): e0263596. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263596
Motavalli, J. (2016). A History of Greenwashing: How Dirty Towels Impacted the Green Movement. Aol. Retrieved: 10.01.2024, URL: https://www.aol.com/2011/02/12/the-history-of-greenwashing-how-dirty-towels-impacted-the-green/?guccounter=1
Mullen, L. (2023). How to identify greenwashing and make sustainable buying decisions. URL: https://www.colorado.edu/ecenter/2023/09/27/how-identify-greenwashing-and-make-sustainable-buying-decisions#:~:text=As%20a%20consumer%2C%20your%20best,uses%20to%20produce%20its%20products.
Segran, E. (2019). H&M, Zara, and other fashion brands are tricking shoppers with vague sustainability claims. Fast Company, 8.
Shahrin, R., Quoquab, F., Jamil, R., Mahadi, N., Mohammad, J., Salam, Z., & Hussin, N. (2017). Green “eco-label” or “greenwashing”? Building awareness about environmental claims of marketers. Advanced Science Letters, 23(4), 3205-3208. https://doi.org/10.1166/asl.2017.7713
Yildirim, S. (2023). Greenwashing: a rapid escape from sustainability or a slow transition? LBS Journal of Management & Research, 21(1), 53-63.
Zimmermann, L., Dombrowski, A., Völker, C., & Wagner, M. (2020). Are bioplastics and plant-based materials safer than conventional plastics? In vitro toxicity and chemical composition, Environment International, Volume 145, 106066, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106066.
NIM Insights Research Magazin VOL. 4 (2024). URL: https://www.nim.org/publikationen/nim-insights-research-magazin/detail-ausgabe/nim-insights-research-magazin-vol-4
Kontakt
Artikel mit diesem Thema
Hier finden Sie weitere spannende Artikel, die sich mit diesem Thema beschäftigen.