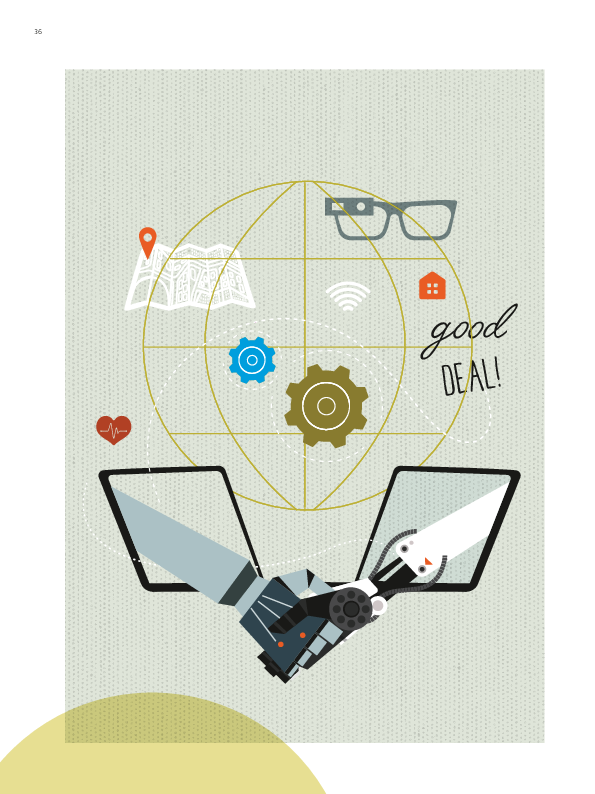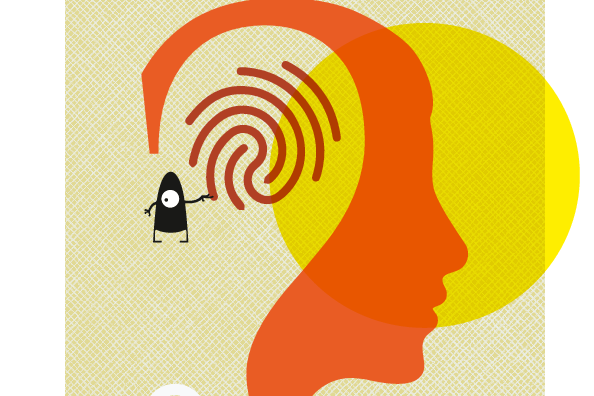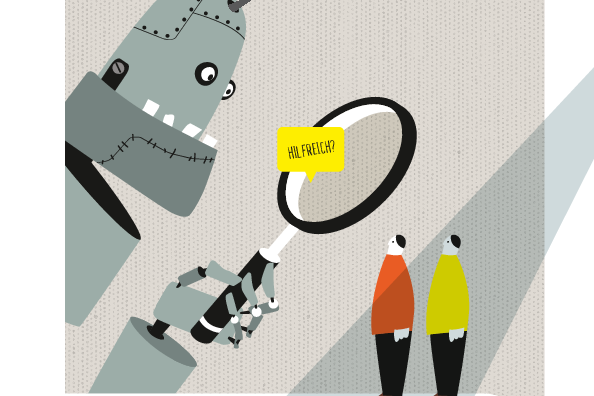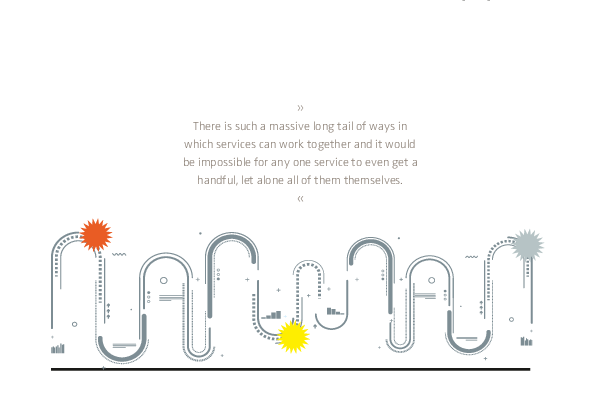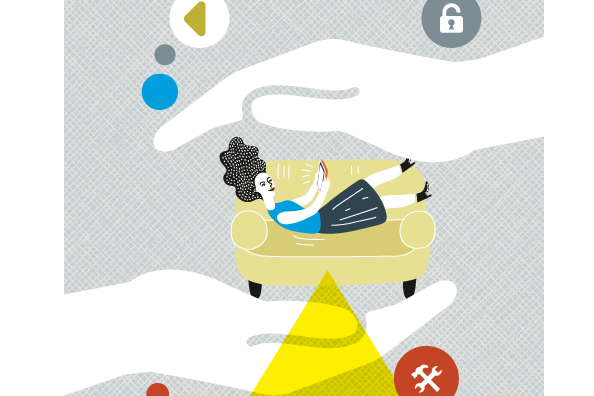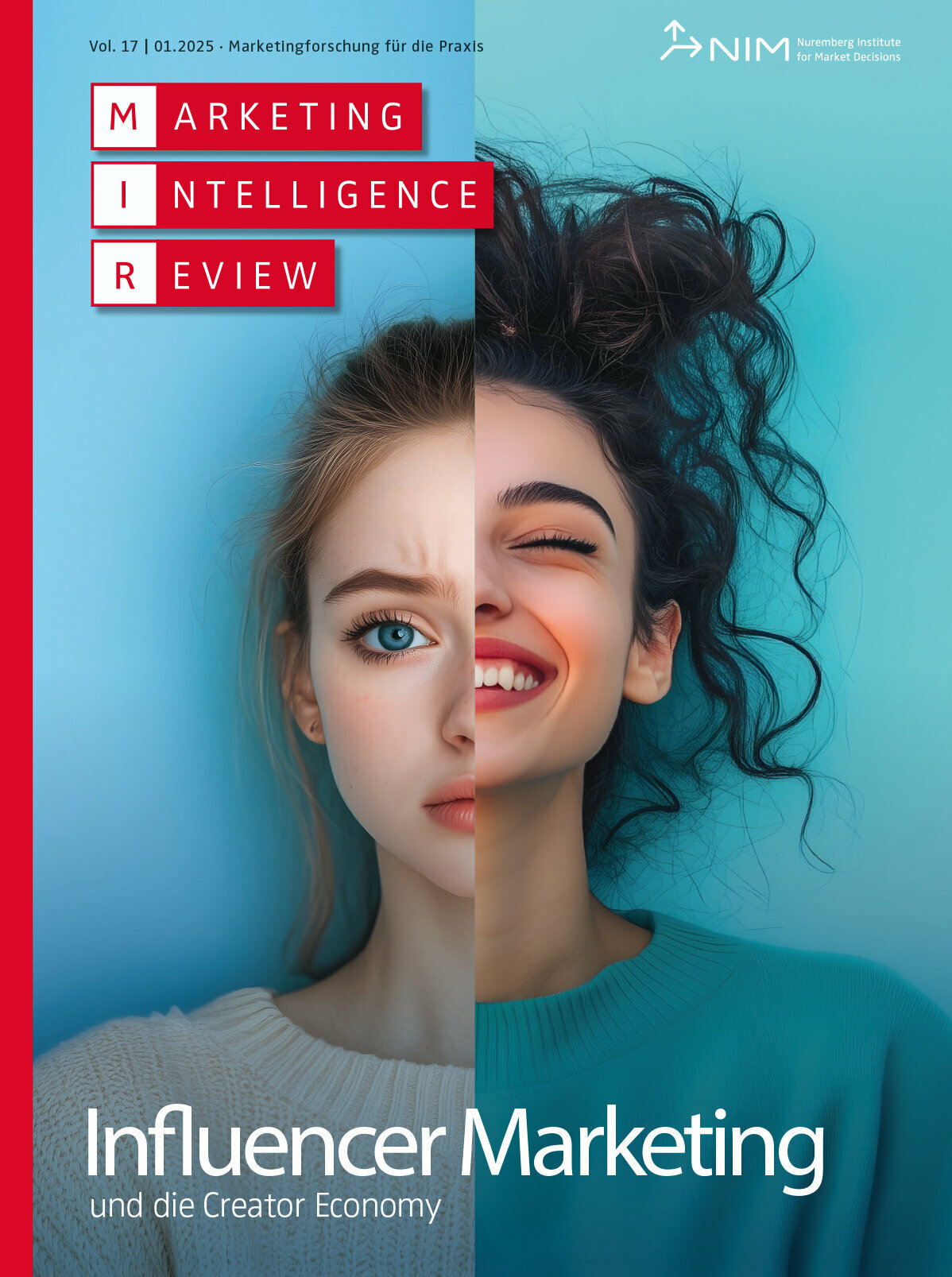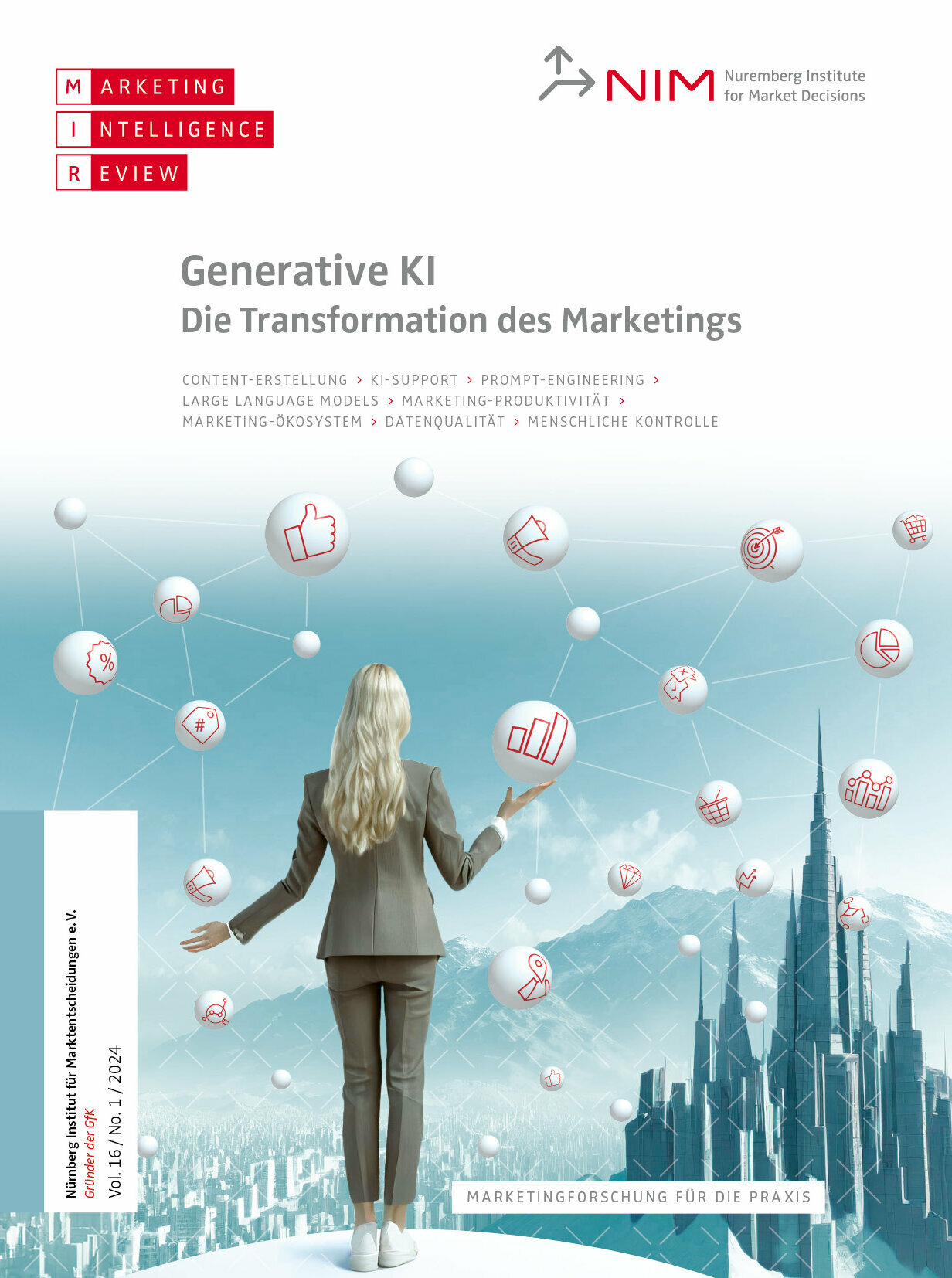Das komplexe Netzwerk der Dinge: Wenn Technologien eigenständig Geschäfte machen
William Rand
Was Konsumenten vom IoT mitbekommen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Unter der Oberfläche interagieren Dutzende Anwendungen miteinander. Um in diesem komplexen Umfeld erfolgreich zu sein, muss eine Marke innerhalb des Netzwerks funktionieren und sicherstellen, dass die eigenen Botschaften letztendlich auch den Konsumenten erreichen. Da IoT-fähige Geräte mit anderen Anwendungen des Systems kommunizieren, dürfen nur gültige Informationen ausgetauscht werden. IoT-Entwickler sollten allfällige Probleme innerhalb des Gesamtsystems vorhersehen. Wenn Sicherheitsaspekte unterschätzt werden, gefährdet man alle Komponenten und auch die Konsumenten. Die Daten bezüglich des Nutzungsverhaltens der Konsumenten helfen Unternehmen, eine bessere Vorstellung darüber zu bekommen, was die Menschen von IoT-fähigen Geräten tatsächlich erwarten. Mithilfe dieses Wissens können sie passendere Lösungen entwickeln und dadurch auch ihre eigenen Ziele besser erreichen.
Literaturnachweise
- Holland, J. H. (2000): Emergence: From chaos to order. OUP Oxford.
- Mitchell, M. (2009): Complexity: A guided tour. Oxford University Press.
- Rand, W. and Rust, R. T. (2011): “Agent-based modeling in marketing: Guidelines for rigor”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 28 (3), 181-193.
- Sterman, J. D. (2000): Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world (No. HD30. 2 S7835 2000).