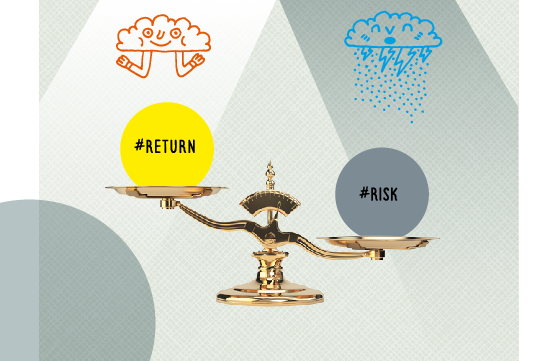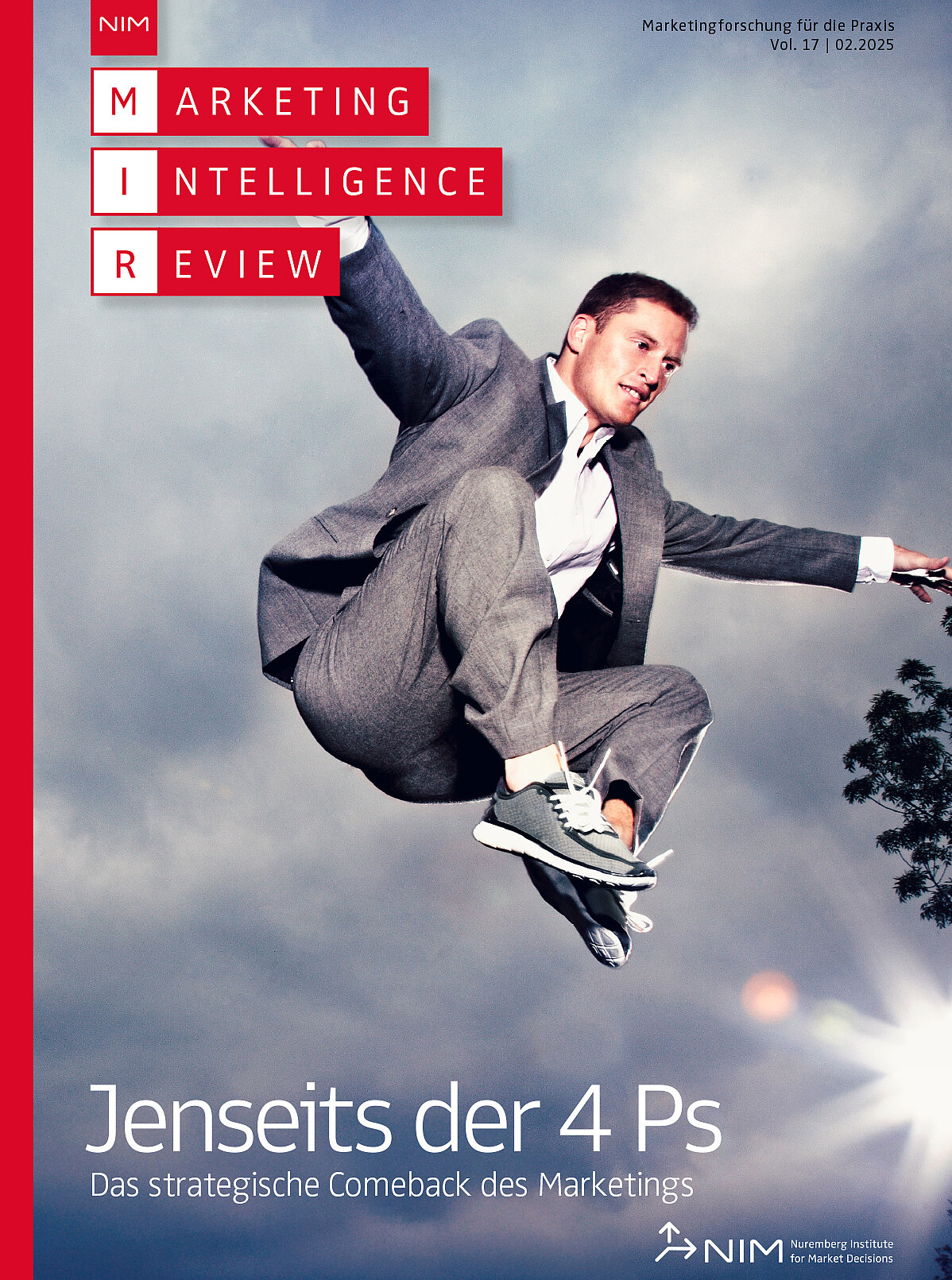Lass dich nicht fressen: Kannibalisierungsrisiken verstehen und vermeiden
Charlotte Mason und Kaushik Jayaram
Um Ertrags- und Marktanteilsverluste so gering wie möglich zu halten, sollte man die Treiber der Markenkannibalisierung verstehen. Für dieses Risiko kritische Markenfaktoren betreffen den Preis und die Qualität im Vergleich mit bestehenden Produkten. Zusätzlich beeinflussen die Kategorie, die Art des Produkts und das Distributionssystem das Ausmaß des Risikos. Auch, ob neue Produkte die alten ersetzen oder mit ihnen am Markt koexistieren sollen, muss überlegt werden.
Bei der Abschätzung des Kannibalisierungsrisikos sollten die Kosten der gesamten Leistungserstellung berücksichtigt werden. Sorgfältig planen und kommunizieren sollte man die Positionierung neuer Marken. Produkte ohne ausreichende Differenzierung könnten Konsumenten verwirren. Die Besonderheiten einer Kategorie sowie Konsumgewohnheiten liefern Ansatzpunkte, um das Ausmaß einer unvermeidlichen Kannibalisierung möglichst gering zu halten. Das wichtigste Beurteilungskriterium ist der Ertrag. Wenn ein Neuprodukt mit einer kleineren Marge zulasten eines ertragreicheren Produkts geht, werden Erträge vernichtet. Ein ertragreiches Produkt, das ein ertragsschwaches verdrängt, rechtfertigt hingegen meist das Kannibalisierungsrisiko.
Literaturnachweise
- Yu, Howard and Malnight, Thomas (2016): “The Best Companies Aren’t Afraid to Replace Their Most Profitable Products,” Harvard Business Review, July, https://hbr.org/2016/07/the-best-companies-arent-afraid-to-replace-their....
- Nijssen ,Edwin; Hillebrand, Bas and Vermeulen, Patrick (2005): “Unraveling Willingness to Cannibalize: A Closer Look at the Barrier to Radical Innovation,” Technovation¸ Vol. 25 (12), 1400-1409.
- Srinivasan, Sundara; Ramakrishnan, Sreeram and Grasman, Scott (2005): “Identifying the Effects of Cannibalization on the Product Portfolio,” Marketing Intelligence and Planning, Vol. 23(4/5), 470-485.